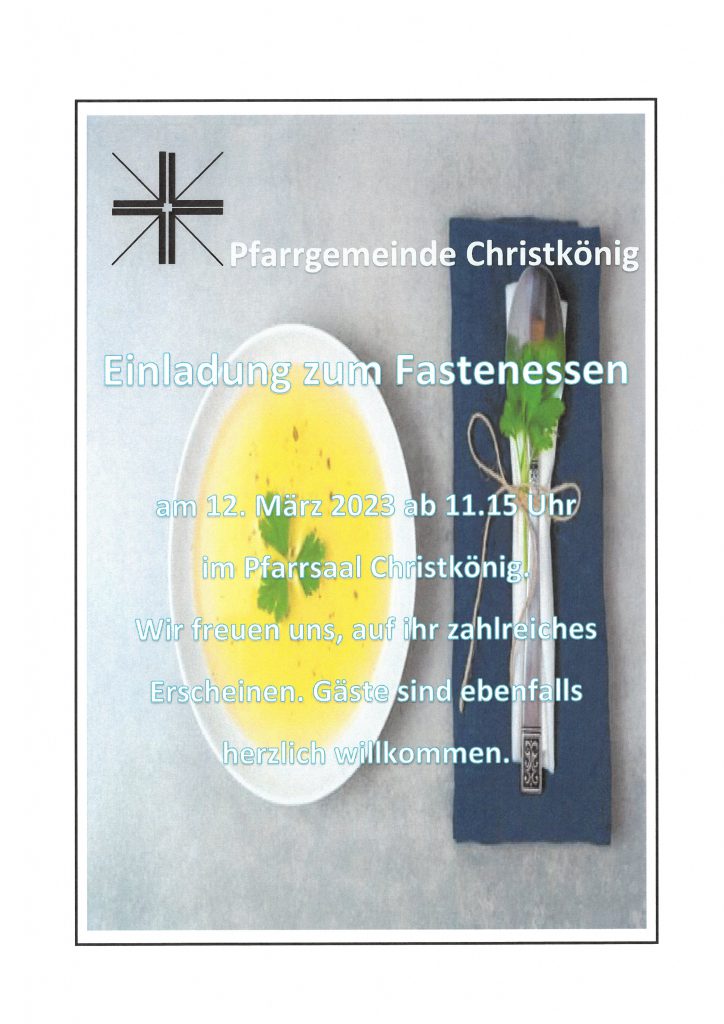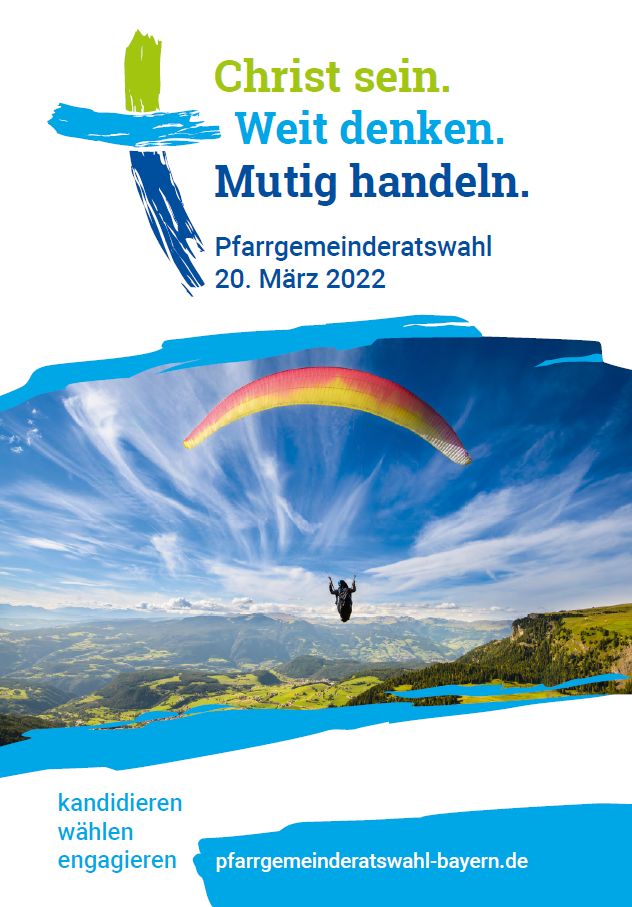Pfingsten 2023: Jesus lässt uns nicht als Waisen zurück
Jesus hinterlässt seinen Jüngern seine Worte und Gebote, sein Lebensbeispiel und schließlich seinen Geist. Dies ist auch für uns heute noch die Grundausrüstung, mit der wir in der Nachfolge Jesu unseren Weg gehen. Jesus lässt uns nicht als Waisen zurück. Er verheißt und sendet uns tatsächlich den Heiligen Geist – das nennen wir Pfingsten. Was soll das wohl für uns bedeuten? Man könnte es so zusammenfassen: Ich sende euch fort; werdet selbstständig, mündig, geht euren Lebensweg unter der Führung des Heiligen Geistes; ihr seid nicht allein; ich bin bei euch bis zum Ende der Welt. Eben! Der Geist ist das innerste Geheimnis zwischen Mensch und Gott. Von welchem Geist ist hier die Rede? Heiliger Geist muss unterschieden werden von bösen Geistern. In den synoptischen Evangelien findet man Dämonenaustreibung als Befreiung von parasitären Hausbesetzern (z.B. Mt 8,28-34). Dämonen sind Schadensgeister in physischer und psychischer Hinsicht. Aber wenn der Messias kommt, haben Dämonen ihre Macht verloren.
Wir alle haben den menschlichen und den göttlichen Geist in uns. Da ist es wichtig, die Geister zu unterscheiden und zu erforschen. Man muss ständig reflektieren: Welcher Geist herrscht in mir? Wieso bin ich unruhig? Ist es Freude, Nervosität oder Angst? Karl Barth (1886-1968), evangelischer Theologe, benennt seine Dogmatik III: „Der Geist als Grund der Seele und des Leibes“: d.h. Wir haben Gottes Stimme in uns. Man sucht Gott überall und findet ihn in sich selbst, besonders durch Stille, durch Reflexion. Das will heißen: sich nach innen wenden, beten. Das verlangt Ruhe, hinhören schweigen. Das Gewissen ist die gottgegebene Instanz, die zu guten Entscheidungen führen soll, zu einem Ja oder Nein in bestimmten Situationen, auch zu handeln oder etwas zu unterlassen. Gott hat uns dazu den freien Willen gegeben.
Der Heilige Geist leistet uns seinen Beistand auf unserem Weg in die Mündigkeit. Jesus verlässt diese Erde als Mensch aber Gott verlässt uns nicht! Er sendet uns vielmehr den Geist, gibt uns die Gaben des Geistes, damit wir wissen, wie wir weiterleben sollen. Denn: Er ist auch kein „Helikoptergott“, der aufpasst und ständig kontrolliert. Das widerspräche dem freien Willen des Menschen. Dennoch verspricht er seinen Beistand. Der Geist Gottes wirkt in uns, damit wir uns entfalten können, um aus selbst verschuldeter Unmündigkeit frei zu werden (Immanuel Kant, 1724-1804). Dazu hilft uns das Gewissen, wie bereits erwähnt. Gewissen ist doch der Mittelpunkt christlicher Anthropologie. Durch den Heiligen Geist entwickelt Gott für uns Menschen Autorität aus unserem Inneren, damit wir Gott ähnlich werden. Jesus will uns ja nicht als Waisen zurücklassen. Er ist in uns und geht mit uns.
Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie persönlich die Gaben des Heiligen Geistes wohl erkennen und annehmen.
Ihr Pfarrer
Dr. Dr. Emeka Ndukaihe
Gedanken zu Ostern 2023
Liebe Gemeinde,
Auferstehung hat mehrere Facetten. In dieser Nacht der vielen Erzählungen erfahren wir einen gemeinsamen Durchzug durch die Geschichte Israels und damit auch den schwierigen Weg unseres Christseins. Gott führt sein Volk aus der Sklaverei in die Freiheit der Kinder Gottes – eine andere Art von Auferstehung. Die vielen Stationen in den biblischen Erfahrungstexte können auch eine Widerspiegelung unseres Lebens sein. Manche davon sind vielleicht nicht unsere persönlichen, aber doch die von vielen Frauen und Männern.
Der Exodus-Text zeigt, dass Gott punktgenau führt. Wir erkennen allerdings vieles davon erst im Nachhinein, im Rückblick. Gott hat die Israeliten vor dem Leid in Ägypten, und vor dem Tod in der Wüste errettet und neues Leben geschenkt – eine Auferstehung. Der liturgische Festkreis, ja auch der Alltag selbst, lehren uns, dass Tod und Leben sehr nahe beieinander sind. Der Glaubensformel des Neuen Testaments „Gott, der Jesus von den Toten erweckt hat“ steht der Satz des Alten Testaments gegenüber „Gott, der dich aus Ägypten geführt hat.“
Diese Befreiungserfahrung aus Ägypten dürfen wir auch heute mit der Feier der Auferstehung des Herrn erleben. In der Tat ist heute Ägypten dort, wo es Ausbeutung der Arbeitskraft gibt, wo Profite nicht hoch genug sein können und viele ihre Arbeitsplätze verlieren. Ägypten ist dort, wo Menschen Schmach und Beleidigungen ausgesetzt sind, wo ihre Menschenwürde nicht ernst genommen wird, wo sie sich in ihren Beziehungen, in ihrer Arbeitswelt eingeengt fühlen, wo sie unmündig gemacht werden, das heißt, all ihren Schmerz, ihre Trauer nicht artikulieren können und dürfen. Ägypten ist dort, wo die Sklaverei heute auch in neuer Form das Sagen hat.
Befreiung aus jeglicher Form der Sklaverei ist mit der Auferstehung des Herrn angebahnt. Unsere Verwundungen und Wundmale, die wir hinzunehmen haben, die wir aber auch anderen bewusst oder unbewusst schlagen, sind auch die Wundmale des Herrn, die in der Osterkerze in kreuzförmiger Gestalt dargestellt sind. Ostern lädt uns ein, der Macht des Bösen, der Macht des Todes Hoffnung entgegenzusetzen. Es ist jene Hoffnung, die durch die Errettung aus Ägypten und durch die Auferstehung Jesu zur Realität geworden ist.
Im Namen des Pfarrteams wünsche ich Ihnen allen ein gesegnetes Osterfest.
Ihr Pfarrer,
Dr. Dr. Emeka V. Ndukaihe
Geburt von Fürst des Friedens
Liebe Gemeinde, liebe Mitchristen,
Weihnachten ist das Geburtsfest des Königs des Friedens. Wir leben in einer Welt voller Streit, Gewalt und Krieg, in einer Welt des Unfriedens, der Ausbeutung und Unterdrückung. Dies erfüllt Menschen mit Angst, Schrecken, Verzweiflung und großer Sorge. Wir spüren unsere Ohnmacht. Umso wichtiger ist es, Hoffnung zu fin-den in der Friedensbotschaft des Friedensfürst, Jesus Christus, dessen Geburt wir zu Weihnachten feiern. Seine Geburt und sein Leben künden von Frieden; darum erscheint Gott unter den Menschen in Gestalt eines unschuldigen Kindes. Sein Leben war friedfertig und seine Worte stifteten Frieden. „Friede sei mit euch!“ -Das ist der Gruß des Auferstandenen an seine Jünger und damit setzt er seine Friedensbotschaft sogar über den Tod hinaus fort.
Die Mahnung zum Frieden finden wir zahlreich in der Bibel, z.B. im A.T. ist zu lesen: „Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht. … Denn uns ist ein Kind geboren … Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter, man nennt ihn: Wunderbarer Ratgeber, Starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Seine Herrschaft ist groß, und der Friede hat kein Ende … Er festigt und stützt sein Reich durch Recht und Gerechtigkeit, jetzt und für alle Zeiten“ (Jes. 9,1-6). Aus dem N.T. hören wir: „Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne Gottes genannt werden“(Matt.5,9). Auch im Hebräerbrief(12,14) steht: „Strebt voll Eifer nach Frieden mit allen!“. Daher ist Friede eine zentrale Botschaft des Herrn, die sich an uns alle richtet und von jeder und jedem von uns auch Anstrengungen erfordert.
Im Apostolischen Schreiben „Evangelii Gaudium“ unterscheidet Papst Franziskus zwischen einem falschen und einem authentischen, wahren Frieden: „Der soziale Friede kann nicht … als eine bloße Abwesenheit von Gewalt verstanden werden, die durch die Herrschaft eines Teils der Gesellschaft über die anderen erreicht wird. Auch wäre es ein falscher Friede, wenn er als Vorwand diente, um eine Gesellschaftsstruktur zu rechtfertigen, welche die Armen zum Schweigen bringt und ruhig stellt.“ Ebenso besteht der Friede nach Meinung von Papst Paul VI. „nicht einfach im Schweigen der Waffen…. Er muss Tag für Tag aufgebaut werden, mit dem Ziel, einer von Gott gewollten Ordnung, die eine echte Gerechtigkeit unter den Menschen herbeiführt.“ Darum betont Papst Johannes Paul II.: „Es ist nie zu spät, um einander zu verstehen und Verhandlungen fortzusetzen, denn Krieg ist immer eine Niederlage für die Menschheit.“ Die Einladung Jesu, Frieden zu stiften, und für Gerechtigkeit zu sorgen ergeht heute an uns alle, die seine Geburt feiern; und darüber hinaus an die ganze Welt. Weihnachten bleibt somit ein Geschenk des Friedens, aber auch ein Aufruf zum Frieden: Eine Gabe und eine Aufgabe zugleich!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen, auch im Namen des Pfarrteams, eine fröhliche und gesegnete Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins Neujahr 2023.
Ihr Pfarrer
Dr. Dr. Emeka V. Ndukaihe
Der Start in den Sommerferien
Die Ministranten haben den Start in ihre Sommerferien und das Ende des Schuljahres dieses Jahr gebührend mit einem gemeinsamen Ausflug in den Straubinger Tiergarten genossen. Anschließend wurde gegrillt und zusammen Spiele gespielt. Als die erste größere Ministranten-Aktion seit Corona wurde der sonnig kühle Tag sehr gut ausgeschöpft und die Gemeinschaft durch die gemeinsam verbrachten Zeit gestärkt. Die Tischtennisplatte wurde nach langem wieder genutzt und das überstandene Schuljahr konnte entspannt ausklingen.
Text: Theresa Maier
Foto: Andrea Baumgartner
Geistliches Wort zum Pfingstfest 2022:
Pfingsten wird gern als das Geburtsfest der Kirche bezeichnet. Geburtstage verbinden wir mit einer fröhlichen und gelösten Stimmung. In der Kirche von heute ist jedoch das Gefühl von Starre und Lähmung zu spüren. Wir dürfen es nicht so stehen lassen. Bei runden Geburtstagen werden gerne Bilder aus vergangenen Jahrzehnten gezeigt, die an das Schöne und Gelungene im Leben des Geburtstagskindes erinnern. Wenn wir an belebende Erfahrungen der Kirche mit dem Geist Gottes denken, kann es uns auch Pfingsten erschließen. Wenn wir ahnen, was Gottes Geist wollte und tat, können wir auch ahnen, wo und wie wir den Geist heute erfahren können und weiter blühen lassen. „Die Erfahrung“ von Pfingsten damals war erlebbar durch die Predigt des Petrus in Jerusalem. Da konnte er Bilder und Worte finden, in denen Pfingsten verdeutlicht werden kann. Darin erleben wir, dass Pfingsten also da ist, wo Menschen von Christus und seiner Botschaft überzeugt sind. Das geschieht noch heute.
Die Zeit, als die Kirche ihr zweites Vatikanisches Konzil abgehalten hat, wurde auch als Pfingsten der Kirche beschrieben und erlebt. Es bestand im gegenseitigen Hinhören und in der Sehnsucht, die „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen“ zu verstehen und zu teilen. Es war die Zeit, in der neue Bilder des Glaubens in der Welt geteilt wurden. So kann Pfingsten heute darin bestehen, die Texte dieses gemeinsamen Suchens ernst zu nehmen und weiter zu Verlebendigen. Manche Freude und Hoffnung, manche Trauer und Angst sind noch immer dieselbe wie vor dem Konzil. Dazu sind aber manche neu entstanden und drängen mehr. Vielleicht kann aus dem ganzen noch etwas werden, was Gott uns erst noch zeigen will.
Pfingsten zu feiern ist mehr als eine Erinnerung an das Fest von damals. Durch den Jahreskreis der Kirche stellt man fest: Weihnachten kann das Nachdenken darüber sein, dass Gott in die Welt gekommen ist. Gott wurde Mensch um uns zu zeigen, wie das Menschenleben gelingen kann. An Ostern spüren wir das Leben, an dem wir als Erlöste Anteil haben. Darin haben Leid und Tod nicht das letzte Wort, sondern die Auferstehung. Dabei kann man verweilen. Bei Pfingsten aber kann man nicht verweilen. Pfingsten hat so viel an Bewegung und so viel mitreißende Kraft, dass es uns mitnehmen will. Pfingsten ist die Einladung an uns, uns auf den Weg zu machen und Gott durch uns handeln zu lassen. Gott steht in vielen Startlöchern. Es liegt an uns, ihm eine Chance zu geben, mitzugehen auf unseren Wegen – in unserem eigenen Leben, im Leben unserer Familie, und im Leben unserer Kirche und Gesellschaft. Also Aufbrechen!
Dr. Dr. Emeka V. Ndukaihe (Pfarrer)
Ostergruß 2022
Liebe Mitchristen, liebe Gemeinde,
die Ostergeschichte ist mit einem Paradox verbunden: Finster und hell, Dunkelheit und Licht. Alles in einer Nacht! Wir versammeln uns in einer ganz dunklen Kirche und dann wird uns das Licht der Osterkerze geschenkt. D.h. Mitten in Dunkelheit geht uns das Licht auf. Es ist, als ob im Leben und um uns herum alles verborgen ist und zugleich neu und sichtbarer wird. Ja! Nur einer kann dieses Paradox lösen – Jesus Christus – der als Licht der Welt die Dunkelheit überwinden kann. Wir stoßen immer wieder in den Osterlesungen auf diese Dunkelheit – die Schuld, in der sich Menschen verstricken. Manchmal bewusst aber oft unbewusst, meistens sogar ohne Absicht. Heute sind wir in Europa und vielen anderen Teilen der Welt mit der Dunkelheit des Krieges konfrontiert. Die Wirkung ist enorm. Ja! Es geschieht so vieles in der Welt, das böse ist und Böses macht. Teils akzeptiert, verharmlost und teils verschwiegen. Trotzdem kennt einer – Jesus- dieses Paradox gut und kann in der Dunkelheit das Licht scheinen lassen.
Traditionell erneuern wir im Osternachtgottesdienst unser Taufversprechen. Für uns Christen ist die Taufe Dreh- und Angelpunkt einer neuen Zukunft. Auch einer neuen Welt. Der alte Mensch kann sterben, der neue wird auferstehen. Wobei der alte Mensch nichts mit dem Lebensalter zu tun hat, der neue auch nicht. Alt ist alles, was Leben zerstört, was Hoffnungen tötet, was Angst macht – neu ist alles, was in der Liebe geschieht, was Zukunft gewährt, was Glauben schenkt. Verwundert, fast schon ein wenig betroffen denke ich an mich: Was ist denn in meinem Leben immer noch alt, was neu? Jesus, der für uns gestorben ist, der für uns von den Toten auferstand ist, nimmt uns in der Taufe in sein Leben hinein. In der Osternacht lassen wir uns daran erinnern. Ja, wir versprechen ihm -Jesus- neu, den alten Mächten abzusagen und an ihm festzuhalten.
Das Szenario des leeren Grabes ist in sich auch ein Paradox. Wir hören von Frauen, die mit dem Tod Jesu alle Hoffnungen verloren haben. Auch die Hoffnung, dass das Reich Gottes anbrechen würde. Der Tod hat scheinbar alles, was Jesus gesagt und getan hat, zunichte gemacht. An diesem Morgen scheint noch mehr tot zu sein als nur Jesus. Und genau aus diesem Tod dürfen sie auf Leben hoffen. Plötzlich sagte ein Engel zu ihnen: „Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier.“ Also, nicht einmal der Tod kann Jesus wegschließen. Ja! Nach den Ereignissen am Karfreitag löste das leere Grab weitere Verzweiflung aus, aber die Worte des Engels erzeugten wieder Zuversicht. Die Hoffnung ist wieder erwacht! Überzeugter wird es: Wir sind nicht Zeugen des Todes, wir sind Zeugen des Lichtes, Zeugen seines Lebens – Jesus Christus. Fortan, mit der Auferstehung beginnt Gott seine Schöpfung neu. Für Menschen, die immer noch im Bann des Todes stehen, Angst kennen oder Angst machen: Es bricht eine neue Zeit an.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein frohes und gesegnetes Osterfest!
Pfarrer E. V. Ndukaihe
(Im Namen des Pfarrteams)
Eine Begegnung voller Freude und Hoffnung!
Schön, dass wir das erleben dürfen! Zwei Menschen treffen sich, zwei werdende Mütter! Die eine ist fast schon zu alt! Die andere fast noch zu jung! Die eine hat ganz viel Geschichte hinter sich – die andere noch ganz viel vor sich. Elisabeth und Maria. Zwei verschiedene Generationen. Doch worauf es ankommt – das sind die Kinder. Was von ihnen zu sehen ist? Gewölbte Bäuche; das Schweben zwischen Freude und Zweifel! Aber auch gleich voller Hoffnung. In seinem Evangelium erzählt Lukas (1,38-45) von dieser einmaligen Begegnung. Eine Wiederholung hat es leider nicht gegeben. Nur die beiden Kinder werden später ständig irgendetwas miteinander zu tun haben.
Merkwürdig an diesen beiden Menschen ist: Die Freude von Elisabeth gilt nicht dem Kind, das in ihrem Bauch wächst – sie freut sich überschwänglich über das Kind, das im Bauch der Maria darauf wartet, das Licht der Welt zu erblicken. Die alte Frau nennt das noch nicht geborene Kind sogar ihren Herrn! Große Dinge scheinen sich anzukündigen, von denen wir noch wenig wissen. Was weiß Elisabeth? Maria ist in dieser Begegnung still. Sie sagt – außer ihrem Gruß, als sie das Haus betritt – kein Wort. Sie hört zu und überlegt die Aussage Elisabeths in Dankbarkeit.
Die Bewegung des Babys im Bauch könnte so gedeutet werden: Johannes freut sich auf Jesus! Johannes freut sich darüber, dass die alten Verheißungen Gottes in Erfüllung gehen. Dabei ist Johannes noch nicht einmal geboren! Das macht diese Geschichte schön und spannend. Bevor nur ein Wort gesagt wird, wandert die Freude über die Bäuche der Frauen. Es ist jetzt nicht das Gesicht, auch nicht die Augen, die lachen – es ist der Bauch! Diese Lukas Geschichte ist einmalig: dass ein Bauch vor Freude bebt, hat die Welt bis dahin noch nicht gesehen.
Diese Begegnung zwischen Elisabeth und Maria ist eine intime Szene – eigentlich. Von Lukas aber so gemalt, dass die ganze Welt zusehen soll. In der Begegnung dieser beiden Frauen treffen Welten aufeinander: die „alte“ Welt, die die Hoffnung noch nicht aufgegeben hat – und die „neue“ Welt, die Schalom, Frieden, Heil bringt. Hier treffen Hoffnungen aufeinander. Dass Gott so klein anfängt, passt ER doch tatsächlich in einen Bauch.
In dieser Begegnung spüren wir Zärtlichkeit und Nähe. Man fühlt die Wärme der Haut, die Wärme des Atems. Die leisen Worte. Die Hand der Elisabeth – sie liegt jetzt auf dem Bauch der jungen Frau – und spürt wie sich das Kleine bewegt. Wir sehen die Geborgenheit. Eine Hand legt sich auf die Schulter, die andere auf den Bauch. Elisabeth freut sich, ihr Kind freut sich auch, und schenkt Maria Nähe und Wärme, dem Mädchen, das verzweifelt und hilflos einfach dasteht. Maria brachte ihr Kind zur Welt, dann ist Weihnachten.
Nun frage ich mich: Was schenke ich den Andern bei unseren Begegnungen? Angst/Traurigkeit, oder eben Geborgenheit, Freude und Hoffnung? Ja! Dass Menschen in Sicherheit wohnen und glücklich sein können, ist eine Hoffnung von einem Ende der Erde zum anderen. Manchmal braucht der Frieden – nur einen Menschen. Kann ich wohl dieser Mensch sein?
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute, ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neu Jahr 2022.
Bleiben Sie gesund!
Ihr/Euer Pfarrer
Emeka Ndukaihe
„Lichternacht“ in der Pfarrei Christkönig
„Zur Mitte finden“ – betrifft uns alle.
Vorabendgottesdienst zum 3. Adventsonntag „Gaudete“ in der Pfarrei Christkönig
Straubing (spe)
„Gaudete“, so beginnt der Introitus des Dritten Adventssonntags mit dem Wort GAUDETE (Freuet Euch). Die Liturgie stimmt die Gläubigen darauf ein, dass der Herr mit der Erlösungsgnade nahe ist, daher „Freuet Euch“. Pfarrer Dr. Emeke Ndukaihe und Diakon Wolfgang Sattich-Jaklin setzten diese Botschaft um. In den Texten und der musikalischen Einstimmung, die Frau Barbara Fellinger mit einfacher, stimmiger Diktion leistete, spürten die Gläubigen diese .
Brennende Kerzenlichter in Form von Labyrinthen gelegt, bestimmten den Altarraum. Pfarrer Dr. Emeke Ndukaihe thematisierte die Schwierigkeit, die die Menschen haben, die Mitte zu finden. Er formulierte die Herausforderungen des Alltags, worum die Menschen ihren Lebens-mittelunkt kreisen lassen, was ihnen wichtig ist: Auto, Besitz, Beruf und Karriere oder Kinder. Manche Menschen machen sich aber selber zum Mittelpunkt, kreisen nur um sich selbst. Das führt erheblich zur Krise, meinte der Prediger. „Der Grund dafür ist einfach zu benennen!“ meinte Dr. Ndukaihe. Die Zielrichtung ist nämlich falsch gewählt, es fehle Christus, als der Mittelpunkt, als der bestimmende Anker. Lektorin Frau Christa Steindl trug sodann das „Hohelied der Liebe“ vor. Darin wird das Wesentliche ausgedrückt, kommentierte Dr. Ndukaiha, worauf es im Leben ankommt.
Die Geschichte vom „Kleinen Licht“, rezitierte Frau Erna Endner. Die Lichtthematik führte Diakon Wolfgang Sattich-Jaklin mit dem Textbeitrag „Das Licht leuchtet in der Finsternis“ weiter und führte damit erneut zum Kernthema „Mitte finden!“ Die gebrochene, gebrauchte Osterkerze wurde vom liturgischen Dienst, von Frau Andrea Baumgartner, zum Altar ge-bracht, ganz in den Mittelunkt gestellt. Sie sollte symbolisch verdeutlichen, dass es im menschlichen Leben keine leidfreie Zone gebe. Erfolgreiches Leben beinhalte auch den Schmerz, aber auch dessen Überwindung. Der Prediger verwies auf die Kerze und lenkte den Blick auf die Brüche und Schäden, die auf der Kerze zu erkennen sind. „Der Sinn einer Kerze ist es, Licht zu erzeugen, sogar im Modus des Gebrochenen!“ meinte Dr. Ndukaihe. Der Lebenssinn einer Kerze ist es, im Brennen zu vergehen, zu schmelzen; das ist der Sinn des Kerzenlebens. „Auf den Menschen übertragen heißt das, dass wir Menschen durch das Labyrinth des Lebens zwar beschwerliche Wege beschreiten, aber den Lichtstrahl, der uns Orientierung gibt, können wir in Christus erkennen.
Der Weg zur Mitte
Um den Weg zur Mitte zu finden, empfahl Dr. Ndukaiha 5 Schritte. Jeder ist einmalig, einzigartig und unverwechselbar. Und daher sollte sich keiner mit anderen Menschen vergleichen. Die Angst ist ein schlechter Ratgeber; jeder Mensch trägt zwar Ängste und Befürchtungen mit sich; sie sind aber als Herausforderungen zu meistern. Der dritte Rat bezog sich auf die eigene Bequemlichkeit. „Überwinden Sie die Komfortzone!“, meine der Pfarrer. Im nächsten Ratschlag empfahl er sich selbst anzunehmen, so wie man ist und welche Fähigkeiten man mitbringt. Und im Wesentlichen mögen Sie gelassener werden und auch mehr Zeit für sich selber zu entdecken, dann kann man im Labyrinth des Lebens auch die Mitte finden und ein Stück mehr „Selbst“ werden.
In der Pfarrei Christkönig wird diese Botschaft von „Gaudete“, dieses „Freuet Euch“ umgesetzt und somit die Erwartung auf die Geburt des Erlösers vorbereitet.
Wohltuende Ruhe bestimmte den Kirchenraum und die vielen Kerzen, die „Labyrinthe“ des Lebens nachgehen strukturierten den Altarbereich. Sie bestimmen durch ihre Leuchtkraft den Raum, führen den Kirchenbesucher in eine mystische Welt. Das, was wir landläufig mit der „Stillen Zeit“ – als der „Adventszeit“ benennen, wird hier spürbar. Denn in den Texten und Gedanken des Priesters und der Lektoren wird absolut das Hinhören auf den Kern der Umkehr, wie es die Adventszeit mit uns vorhat, umgesetzt. Höchst beeindruckend es ist aber, den Kirchenbesuchern tut diese Abendstunde gut, denn sie bleiben noch lange sitzen, meditierend, in sich einkehrend und wohl die Botschaft der Ankunft des Herrn bedenkend. Und das in der Coronazeit, Hygiene und Abstände berücksichtigend. Somit war die Kirche bis in die „letzte Ecke“ gefüllt!
-spe-
Bilder:
• Kirchenraum in Christkönig – Labyrinth
• Zelebranten (von links) Diakon Wolfgang Sattich-Jaklin und
Pfarrer Dr. Emeke Ndukaihe